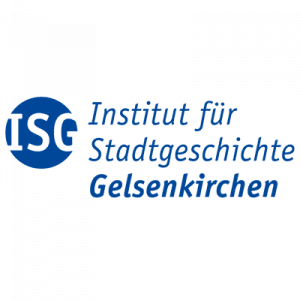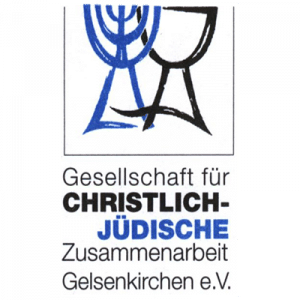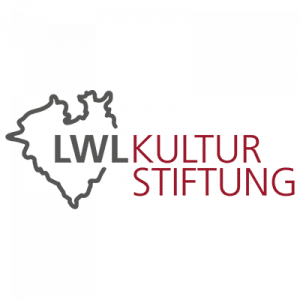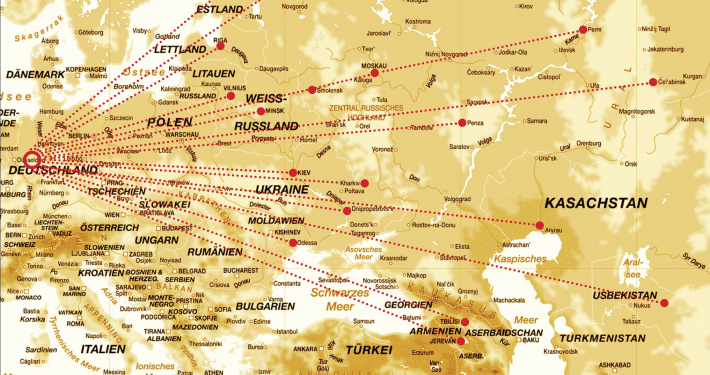Glossar
Davidstern
Ein Sechseckstern soll laut mittelalterlicher Legende auf dem Schild des König David abgebildet gewesen sein. Seit dem 15. Jahrhundert wird er, ausgehend von Prag, als jüdisches Symbol verwendet: Die sechs Zacken stehen für die Schöpfungstage, das mittlere Sechseck für den Schabbat, die insgesamt zwölf Ecken für die Stämme Israels. Seit 1948 ist der Davidstern Teil der Flagge des Staates Israel.
Menora
Die Thora (hebräisch: Lehre, Weisung, Gesetz) ist der erste Teil der hebräischen Bibel, die fünf Bücher Mose. Sie gilt als heiliges Wort – kein Buchstabe darf verändert werden. Auch die geschmückten, von Hand beschriebenen Pergamentrollen sind heilig. Beim Vorlesen wird ein Thorazeiger genutzt, um sie nicht mit der Hand zu berühren.
Der Talmud (hebräisch: Lernen, Lehre, Studium) ist ein Schriftwerk, das die Lehren aus der Thora zusammenfasst und sie aus der Sicht von Gelehrten auslegt. Er gibt Antworten auf alle Fragen des Lebens – so zu den Speisevorschriften, zur Ehe, zu den Festtagen und vielem mehr.
Thora und Talmud
Die Menora ist ein siebenarmiger Leuchter, das wichtigste religiöse Symbol des Judentums. Sie steht für das von Gott geschaffene Licht. Die sieben Arme entsprechen den sechs Schöpfungstagen und dem Ruhetag, dem Schabbat. Eine 4,5 Meter hohe und 3,5 Meter breite Menora steht seit 1956 vor der Jerusalemer Knesset, dem Parlament Israels. Geschaffen hat sie der aus Dortmund stammende und 1933 nach England emigrierte Bildhauer Benno Elkan im Auftrag des englischen Parlaments.
Rabbiner
Ein Rabbiner (im nicht-orthodoxen Judentum gibt es auch Rabbinerinnen) ist ein ausgebildeter Gelehrter der Schrift. Als offizieller Funktionsträger lehrt er die Thora und stellt sicher, dass die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, eingehalten wird – von der Schlachtung über die Speisevorschriften bis hin zur Bestattung. Er übernimmt auch soziale Aufgaben. Oft leitet er auch die Gottesdienste, jedoch ist ihm dies – anders als bei Priestern im Christentum – nicht alleine vorbehalten. Nicht jede jüdische Gemeinde hat einen Rabbiner.
Jüdischer Kalender und Feier- und Festtage
Alle paar Jahre wird ein 13. Schaltmonat hinzugefügt, damit Feier- und Festtage immer zur gleichen Jahreszeit stattfinden.
Das Jahr beginnt im Herbst mit Rosch Haschana, dem Neujahrsfest (2021 vom 6. September abends bis 8. September). 10 Tage später ist dann Jom Kippur, der Versöhnungstag. Mit dem Lichterfest Chanukka (28. November abends bis 6. Dezember 2021) wird an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem vor fast 2.200 Jahren erinnert. Das Purimfest (16. März abends bis 17. März 2022) feiert die Errettung des jüdischen Volkes aus Persien. Das Pessachfest im Frühjahr (15. April abends bis 23. April 2022) erinnert an den Auszug der Juden und Jüdinnen aus Ägypten. Teil des Festes ist der Sederabend mit einem gemeinsamen Abendessen, an dem der Tisch mit Speisen von symbolischer Bedeutung gedeckt wird.
Der Tag des jüdischen Kalenders beginnt am Vorabend mit dem Einbruch der Dunkelheit und endet am Abend des Tages. So auch der Schabbat, der wöchentliche Ruhetag. Er beginnt am Freitagabend mit dem Segen über Brot und Wein, dem Kiddusch, und endet am Samstagabend. Solange ist Arbeiten verboten – nach jüdischer Tradition sind 39 Tätigkeiten, vom Feueranzünden bis zum Tragen von Gegenständen – an dem Tag nicht erlaubt. Der Schabbat ist Vorbild für einen arbeitsfreien Ruhetag am Wochenende, wie er in vielen Ländern der Welt heute üblich ist.
Bar-Mizwa/Bat-Mizwa
An diesem wichtigen Fest werden junge Juden und Jüdinnen im religiösen Sinne volljährig und haben alle religiösen Rechte und Pflichten eines Mitglieds der jüdischen Gemeinschaft: Jungen mit 13, Mädchen mit 12 Jahren. Die Jungen haben bis dahin gelernt, bestimmte Abschnitte der Thora vorzutragen. Der/die Bar-bzw. Bat-Mizwa wird nach dem Gottesdienst in der Synagoge im Familienkreis groß gefeiert.
Kippa
Die Kippa ist eine Bedeckung des Hinterkopfs, die jüdische Jungen und Männer beim Gebet tragen, streng orthodoxe Juden auch im Alltag. Obwohl sie sich nicht auf biblische Gebote oder Vorschriften des Talmuds gründet, ist eine Kopfbedeckung seit dem 17. Jahrhundert in den meisten Synagogen oder auf jüdischen Friedhöfen Brauch. Es gehört zur Höflichkeit auch für Gäste, sich dem anzuschließen.
Die Kippa ist zudem international zu einem jüdischen Erkennungszeichen geworden. Juden, die sie in der Öffentlichkeit tragen, sind in Deutschland und Europa nicht selten antisemitischen Drohungen ausgesetzt.
Koscheres Essen
Lebensmittel, die den jüdischen Speisegesetzen entsprechen, werden als „koscher“ bezeichnet. Demnach müssen Fleisch und Milchprodukte getrennt zubereitet und verzehrt werden. Tiere müssen beim Schlachten geschächtet werden, damit kein Blut im Fleisch bleibt. Schaf, Rind, Ziege, das meiste Geflügel und Süßwasserfisch sind erlaubt, Schweinefleisch, Schalen- und Krustentiere dürfen nicht gegessen werden. Wer die Speisegesetze einhalten will, findet im Internet umfangreiche Listen mit koscheren Lebensmitteln, die im Handel angeboten werden.
Weiterführende Informationen
Ausstellungen
Websites
Bücher
Impressum der Ausstellung
Gelsenkirchen, jüdisch! 1870 bis heute
Ausstellung der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen,
anlässlich des Festjahres „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“
Kooperationspartner: Institut für Stadtgeschichte, Gelsenkirchen; Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Gelsenkirchen
Finanzielle Unterstützung: LWL-Kulturstiftung, Stadt Gelsenkirchen, Bürgerstiftung Gelsenkirchen, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Idee, Konzeption, Texte und Projektkoordination:Stefan Nies, Büro für Geschichte, Dortmund/Hamburg
Wissenschaftliche Beratung: Dr. Daniel Schmidt, Institut für Stadtgeschichte, Gelsenkirchen
Redaktionsteam: Birgit Klein, Judith Neuwald-Tasbach, Stefan Nies und Dr. Daniel Schmidt
Grafische Gestaltung: Fortmann.Rohleder Grafik.Design, Dortmund
Herstellung: Stadt Gelsenkirchen
Herzlichen Dank an alle, die das Projekt mit Informationen, Ratschlägen, Abbildungen und Material sowie finanziell unterstützt haben!
Die Texte und Abbildungen dieser Ausstellung sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion, Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung an anderer Stelle ist nur mit Genehmigung der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen und der Rechteinhaber gestattet. Die Quellen und Rechteinhaber sind unter den verwendeten Abbildungen angegeben. Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber zu ermitteln und korrekt nachzuweisen. Sollten wir hierbei etwas übersehen haben, bitten wir um Nachricht an die Jüdische Gemeinde Gelsenkirchen.